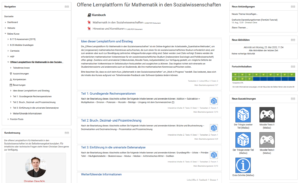Am 17. und 18. Februar 2020 veranstaltete der AK Hochschullehre seine fünfte Jahrestagung des AK Hochschullehre. Die Tagung unter dem Titel „Wozu politikwissenschaftliche Hochschullehre?“ fand im Besuchszentrum der Stiftung Berliner Mauer statt.
Book Launch
Zum Tagungseinstieg wurden zwei neue Bände der AK-eigenen Buchreihe präsentiert. Wolfgang Muno (Rostock) stellte seinen Band „Planspiele und Politiksimulationen in der Hochschullehre“ vor. Er hob die Bedeutung aktivierender Lehrformate für die politikwissenschaftliche Hochschullehre heraus. Sein Band bietet eine systematische Einführung in Simulationsformate und befasst sich insbesondere mit den praktischen Herausforderungen der Vorbereitung und Durchführung von Simulationen. Er sprach sich dafür aus, Simulationen nicht als losgelöste Sonderveranstaltungen zu organisieren, sondern sie in Lehrveranstaltungen zu integrieren, um die Vor- und Nachbereitung didaktisch einzubetten. Die besten Simulationen seien aber diejenigen, in denen Lehrende selbst kaum in Aktion treten und die Studierenden selbst die Zügel in die Hand nehmen.
Als nächstes präsentierten Caroline Kärger (HAW Hamburg) und Judith Gurr (Lüneburg) ihren Band „Lernen im Dialog – aktivierende Methoden in der politikwissenschaftlichen Lehre“. Ihr Band war durch die verbreitete Erfahrung motiviert, dass in Seminaren Gespräche und Diskussionen manchmal nicht richtig in Gang kommen. Dabei sind dialogische und argumentative Kompetenzen für Studierende der Politikwissenschaft besonders wichtig, deshalb sei dies eine besonders wichtige Herausforderung. Das Buch fasst vielfältige Methoden zusammen, die Lehrende praktisch einsetzen können, um Studierende zum Dialog zu animieren. So sollen Studierende lernen, Ambiguitäten zu tolerieren und Gesprächskompetenzen zu entwickeln. Caroline Kärger und Judith Gurr hoben hervor, dass das Buch prinzipiell für alle Lehrenden im Fach hilfreich sein kann, aber auch eine gewisse Bereitschaft seitens der Lehrenden erfordert, sich auf den Dialog mit Studierenden einzulassen.
Panel 1: Simulationen
Zum Einstieg in die Tagung stellten Anne Goldmann, Arno von Schuckmann, Julia Schwanholz und Stefanie Delhees (Duisburg-Essen) einen im Entstehen befindlichen Aufsatz über die Nutzung von Planspielen vor. Neben einer systematischen Einführung in das Thema ist das Herzstück des Artikels die Vorstellung von zwei Planspielen, die an der NRW School of Governance regelmäßig in der Lehre eingesetzt werden. Das erste Planspiel simuliert den Gesetzgebungsprozess im nordrhein-westfälischen Landtag und wird auch physisch im Düsseldorfer Parlamentsgebäude abgehalten, um ein authentisches Setting anzubieten. Das zweite Planspiel befasst sich mit der parlamentarischen Demokratie am Beispiel des Bundestages. In der Diskussion wurden auch grundsätzliche Fragen zu Planspielen aufgeworfen, z.B. zur Bewertbarkeit von Spielleistungen sowie zu den Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Reflexionsphase.
Panel 2: Politische Theorie lehren – wofür und wie?
Der erste Beitrag war von Valerie Scheibenpflug (Wien) zur „Spannung zwischen Selbstzweck und Verwertbarkeit der politisch-theoretischen Lehre an Universitäten“. Sie definierte Theorie als zweckfreie Erkenntnis und wies damit zunächst die Frage nach dem Wozu einer politiktheoretischen Lehre zurück. Universitäten haben ein „philosophisches Moment“ und sollten sich Verwertungszusammenhängen entziehen, um eine kritische Distanz zur Gesellschaft einzunehmen. Außerdem verliere der/die studierende BürgerIn seine/ihre demokratische Mündigkeit, wenn die Universität schon von vornherein alle Lernziele festlege. Allerdings lädt dies Vorwürfe an die politische Theorie ein, sie sei lediglich ein intellektuelles Glasperlenspiel. Damit täte man der politischen Theorie jedoch unrecht, vielmehr sei die Theorie tief in Gesellschaft und Praxis verstrickt und sie könne und dürfe sich der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht entziehen. Dies könne man bereits an der Gründungsgeschichte der deutschen und österreichischen Politikwissenschaft sehen, die in der Nachkriegsphase ein demokratisch-emanzipatorisches und hoch politisches Projekt darstellte. Die Aufgabe der politischen Theorie sei also nicht die Belehrung, sondern darin, gesellschaftliche Erfahrungen zu reflektieren.
Im Anschluss stellte Mareike Teigeler (Lüneburg) ein Seminarkonzept aus der politischen Theorie vor. In ihrem Vortrag zum „Dilemma als Reflektions- und Debattenraum“ rückte sie das Lernziel in den Mittelpunkt, Studierenden Multiperspektivität und Entscheidungskompetenz zu vermitteln. Dazu sollen Studierende durch mehrere Kleingruppenarbeitsphasen Dilemmata in eigenen Erfahrungen herausarbeiten und in einem strukturierten Vorgehen sozial anerkannte Möglichkeiten des Umgangs damit entwickeln. Im Anschluss erfolgt eine gemeinschaftliche Reflexion der Anwendbarkeit abstrakter ethischer Prinzipien. Im Ergebnis zeigt sich, dass aber selbst durch Entscheidungen die fundamentale Unentscheidbarkeit von Dilemmata nicht dauerhaft überwunden werden kann. Dadurch lernen die Studierenden, dass es auf ein Problem unterschiedliche begründbare Antworten geben kann.
Roundtable: Kann man Zielerreichung in der Lehre messbar machen?
Lehre wird heutzutage ständig gemessen – in Lehrevaluationen, Akkreditierung, in Verfahren der landeseigenen Mittelverteilung. Aber (wie) kann dies sinnvoll geschehen? Zu dieser Frage diskutierten Stefan Handtke (Professor für Verwaltungsmanagement an der HTW Dresden, davor drei Jahre Geschäftsführer der Akkreditierungsagentur ACQUIN), Gero Federkeil (Leiter internationale Rankings am Centrum für Hochschulentwicklung) und Lasse Cronqvist (Trier).
Gero Federkeil stellte typische Indikatoren vor, die in Messverfahren des CHE und anderer Institutionen verwendet werden. Diese orientieren sich an zwei Maximen: Erstens sollte vor jeder Messung die Definition von Zielen stehen. Dabei zu beachten: die individuellen/internen Ziele politikwissenschaftlicher Institute stehen immer in Interaktion mit externen Vorgaben, z.B. Zielvorgaben von Hochschulleitungen oder aus der Landespolitik. Zweitens soll bei der Bewertung von Daten deren inhaltliche Validität höher gewichtet werden als deren Verfügbarkeit. Er argumentierte, dass Lehrinstitutionen in der Lehre individuelle Ziele explizit formulieren, ihre Erreichung überprüfen und die dafür erhobenen Daten kontextualisiert (z.B. Abgleich mit Zielgrößen, zeitlicher Verlauf, Vergleich mit anderen) interpretieren sollten. Dabei sollte auch auf qualitative Informationen zurückgegriffen werden, um sich nicht nur auf Kennzahlen zu verlassen.
Stefan Handtke berichtete aus seinen Erfahrungen im Akkreditierungswesen. Derartigen Verfahren liege der Gedanke von Qualitätssicherung und -entwicklung in Forschung und Lehre zugrunde, die im europäischen Hochschulraum eingeordnet und vergleichbar gemacht werden soll. Zur Umsetzung wurde ein europäischer Katalog von Standards formuliert, aber deren genaue Ausformulierung und Interpretation soll in der Autonomie der Hochschulen bleiben. Dabei blieben Zielvorgaben in Bezug auf die Lehre äußerst vage – in Akkreditierungsverfahren wird nicht mechanisch die Erreichung übergeordneter Ausbildungsziele überprüft, sondern gefragt, welche Zielsetzung ein Institut oder eine Hochschule sich selbst gibt und wie diese in Studienprogrammen umgesetzt wird. Ziele sollen sichtbar und diskutierbar sein, müssen aber nicht zwingend überprüfbar oder gar messbar sein, auch wenn es bei manchen Akteuren im Akkreditierungsrat Tendenzen in diese Richtung gibt. Viele Hochschulen wehren sich aber gegen Tendenzen eines kennzahlengestützten Bewertungssystems von Universitäten oder Studiengängen.
In der Diskussion ging es um den Spalt zwischen dem was gemessen wird und „guter Lehre“. Die vorhandenen Instrumente messen so alles mögliche, aber selbst aus einem Abschluss in Regelstudienzeit mit Bestnote kann man nicht ablesen, was Studierende tatsächlich gelernt haben. Dies können letztlich nur die Institute über ihre Prüfungen erledigen, was aber nicht gut vergleichbar ist. Es wurde außerdem thematisiert, dass die große Lehrautonomie im deutschen Wissenschaftssystem Versuche der Steuerung von Lehrleistungen oder des Qualitätsmanagements erschwert. Dies ist auch ein Grundkonflikt in der Systemakkreditierung, wenn Fakultäten diese als Eingriff in ihren autonomen Bereich verstehen. Ferner berichteten manche Teilnehmer, dass in Instituten das eigentlich intendierte Potenzial von Akkreditierungsverfahren, nämlich die strukturierte Entwicklung hochwertiger Studienangebote, durch die Zurschaustellung von Compliance verdrängt werde.
Mitgliederversammlung
Der SprecherInnenkreis berichtete von seinen Aktivitäten seit der letzten Mitgliederversammlung. Aufgrund des Endes der Amtszeit wurde der SprecherInnenkreis anschließend neu gewählt. Nahezu einstimmig (mit einer Enthaltung) wurden gewählt: Matthias Freise (Münster) und Lasse Cronqvist für zwei Jahre, Julia Reuschenbach und Volker Best (Bonn) für ein Jahr. Daniel Lambach (Frankfurt) schied aus dem Kreis der SprecherInnen aus.
In der Aussprache wurde der Wunsch nach fachspezifischen Qualifizierungsangeboten für Nachwuchslehrende geäußert. Eventuell ließe sich ein AK-Angebot auch in landesspezifischen Zertifikatsprogrammen anerkennen lassen. Dies könnte zeitlich an die Jahrestagung angedockt werden, um so auch die Beteiligung an den Tagungen weiter zu steigern. Außerdem sollte sich der AK stärker auf seine Jahrestagung konzentrieren und Zweitveranstaltungen nur noch in Ausnahmefällen organisieren, um seine Kräfte und seine Außenwirkung stärker zu bündeln.
Panel 3: Lehrkulturen und Selbstverständnisse
Christoph Weller (Augsburg) begann den zweiten Tag mit einem Vortrag zum Thema „Ziele, Mittel und Herausforderungen politischer Hochschullehre: Die ‚Augsburger Erklärung‘ im Feld der Friedens- und Konfliktforschung“. Er berichtete aus Diskussionen im AK Curriculum und Didaktik der Arbeitsgemeinschaft Friedens- und Konfliktforschung, in der mit der Augsburger Erklärung ein Text mit Orientierungscharakter verabschiedet wurde, die auch die Wozu-Frage der Tagung beantworten helfen kann. Er riet zur Bearbeitung der Frage mit Studierenden und formulierte mit Aufklärung und Politisierung zwei zentrale Begriffe, um die diese Auseinandersetzung strukturiert werden kann.
Im Anschluss berichtete Carola Klöck von ihren Erfahrungen in der Hochschullehre in unterschiedlichen Ländern. Ihr Beitrag verglich die Lehrpraxis in Deutschland und Frankreich. Sie hob die Unterschiedlichkeit der institutionellen Rahmenbedingungen und Steuerungsinstrumente hervor, z.B. seien an den Sciences Po Abschlussarbeiten nicht verpflichtend und werden nur von einer Minderzahl von Studierenden geschrieben. Außerdem sei in Frankreich die Lehre tendenziell stärker auf die Vorlesung konzentriert und weniger diskursiv als in Deutschland. Ingesamt riet sie zu einer Nutzung deutsch-französischer Kooperationsangebote.
Panel 4: Kompetenzziele
Daniel Lambach stellte die Ergebnisse einer gemeinsam mit Carlo Diehl (Frankfurt) durchgeführten Auswertung von Lehrbüchern der Internationalen Beziehungen (IB) vor. Unter dem Titel „Selbstpräsentation und Lehrziele in IB-Einführungen – Spiegelbild einer fragmentierten Teildisziplin“ diskutierte er die Herausforderungen für Lehrende und Studierende sich den IB als einer pluralistischen (oder: fragmentierten?) Disziplin zu nähern. Die Lehrbücher dieses Bereichs bildeten diese Heterogenität ab, seien aber didaktisch oft zu unambitioniert und inhaltsorientiert. Er schloss seinen Vortrag mit einem Plädoyer dafür, dass sich IB-Lehrende selbstreflexiv mit ihrer Sicht auf die Teildisziplin auseinandersetzen müssten, um ihren Studierenden bei der Orientierung helfen zu können.
Anschließend präsentierte Johannes Schmoldt (Erfurt) einen Beitrag zum Thema „Redefähigkeit als Lernziel? Zur rhetorischen Dimension politischer Urteilsfähigkeit im Rahmen von Demokratieerziehung in der politikwissenschaftlichen Lehre“. Darin argumentierte er, dass der zentrale politische Bildungsauftrag der Politikwissenschaft in der Urteilsfähigkeit liege, womit er den Transfer zwischen Allgemeinem und Speziellem sowie die Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Standpunkten meinte. Seine zentrale These lautete, dass die Sprache das Grundelement des Sozialen und der Politik sei und dass man Urteilsfähigkeit auch mit Redefähigkeiten verbessern könne. Die Fähigkeit zur freien Rede sei somit auch ein Element einer allgemeineren Demokratiekompetenz und sollte daher didaktisch in unsere Lehre eingebunden werden.
Panel 5: Ausbildungsziele I: Forschungsorientierung und Lehrerbildung
Zunächst stellte Ignaz Völk die Ergebnisse einer „Netzwerkanalyse führender Ausbildungsinstitute der Politikwissenschaft in Deutschland“ vor, die er in Kooperation mit Simon Ullrich (beide Kopenhagen) durchgeführt hat. Damit möchten sie die Mechanismen der Selbstreproduktion des akademischen Feldes über die Ausbildungswege an deutschen Universitäten untersuchen. Dazu analysierten sie Lebensläufe von 126 ProfessorInnen an 11 politikwissenschaftlichen Instituten und codierten, wo diese wichtige Karriereschritte (MA/Diplom, Promotion, Habilitation) absolvierten. Dabei zeigte sich, dass ProfessorInnen teils mehrere Schritte am selben Institut absolvieren; man kann aber auch andeutungsweise „Pfade“ zwischen bestimmten sendenden und empfangenden Instituten erkennen.
Danach diskutierten Lara Möller (Wien) und Alexander Wohnig (Siegen) die Rolle der politikwissenschaftlichen Hochschullehre in der LehrerInnenbildung, wo sie einerseits fachwissenschaftliche Ausbildung, aber auch eine didaktische Handlungsfähigkeit vermitteln soll. Letztere bedarf Sinnbildungskompetenzen, die an subjektive Vorstellungen anknüpfen und diese zum Ausgangspunkt des Lernens machen. LehrerInnen werden heute mit einer Vielzahl von Anforderungen konfrontiert (z.B. Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Extremismusprävention, Förderung von Partizipation). Dabei beobachten Möller und Wohnung eine Individualisierung und Entpolitisierung von strukturellen Problemen durch angehende LehrerInnen und in einschlägigen Lehrmaterialien. Sie schlagen eine konfliktorientierte Politikdidaktik für die Ausbildung aktiver und mündiger LehrerInnen vor.
Panel 6: Ausbildungsziele II: Anwendungsorientierung
Im letzten Panel der Tagung stellte ein Team von Lehrenden vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-Essen (UDE) ihr Konzept für die Masterstudiengänge des Instituts vor. Henrik Schillinger stellte in einem einleitenden Beitrag unter dem Titel „Nur eine Marketingstrategie? Was Anwendungsorientierung in den politikwissenschaftlichen Masterstudiengängen der Universität Duisburg-Essen tatsächlich bedeutet“ verschiedene Konzeptionen von Anwendungsorientierung vor. Matthias Freise kommentierte den anwendungsnahen Duisburger Ansatz aus Münsteraner Perspektive und formulierte eine Reihe von Fragen, die von Anne Goldmann, Daniel Lambach und Toralf Stark als RepräsentantInnen der drei Duisburger Masterstudiengänge beantwortet wurden. Dabei wurde deutlich, dass für Studierende Stichworte wie Anwendungs- und Praxisorientierung bei der Masterwahl durchaus wichtig sind, auch wenn sie dies oft auf Fragen der Berufsqualifizierung verengen. Wenn sich ein Institut mit derartigen Zielen identifiziert, muss dies aber glaubwürdig und konsistent umgesetzt werden, wofür es eine Reihe von Instrumenten und Modellen gibt.